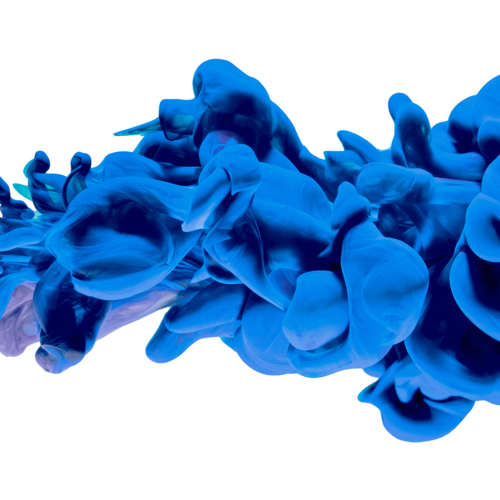- Perspektivenwechsel
«Der Begriff der Identität erhält eine andere Bedeutung»
Die Ansprüche an Wohnraum haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert: Globalisierung, Digitalisierung, eine höhere Lebenserwartung, Migration, Klimawandel, Pandemie, neue Arbeitswelten und individuelle Lebensentwürfe fordern Planerinnen und Planer heraus. So vielfältig, wie wir Menschen sind, so vielfältig sind unsere Wohnformen. Wie und wo wir wohnen, verrät viel über unsere Werte, Vorstellungen und Bedürfnisse – und über unsere Identität.
25.08.2022
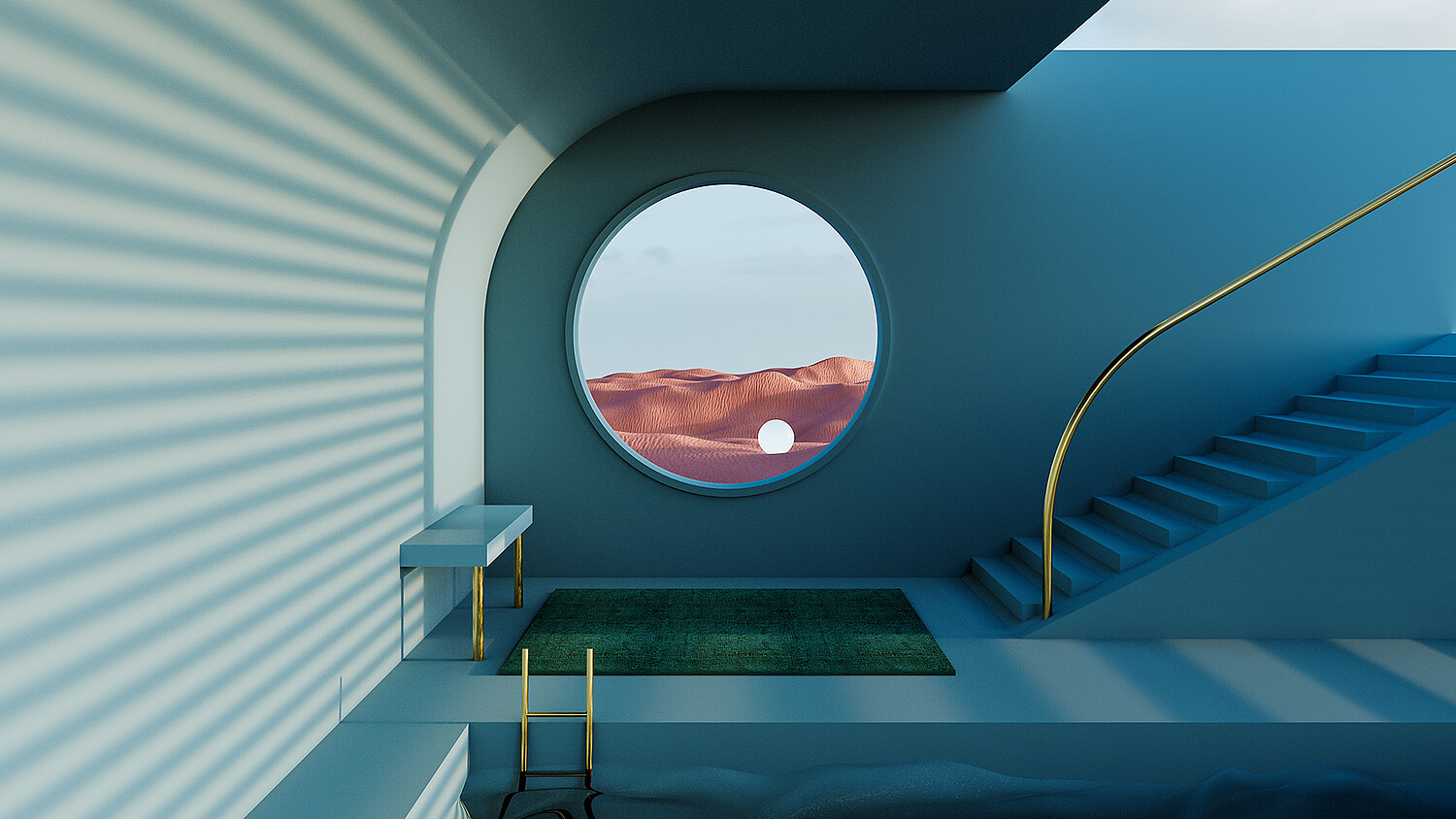
Im Gespräch mit Axel Simon, Architekturkritiker und Redaktor bei «Hochparterre»
Wir Menschen werden zahlreicher, und wir beanspruchen mehr Quadratmeter pro Person. Die Nachfrage nach Wohnraum steigt bei endlichen Bodenressourcen. Die Lösung heisst Entwicklung nach innen, Verdichtung. Wir müssen zusammenrücken. Wie gehen insbesondere junge Architektinnen und Architekten mit diesen Herausforderungen um?
Das stimmt, wir müssen zusammenrücken, weil wir mehr werden und der Platz entsprechend weniger. Und es gibt einen weiteren wichtigen Faktor, der erschwerend dazukommt: die Klimakrise. Sie ist gerade für junge Kolleginnen und Kollegen Thema Nummer 1. Bezogen auf Architektur bedeutet dies, dass wir nicht mehr so bauen können, wie wir es lange Zeit gemacht haben. Ein Beispiel: Alte Siedlungen sind CO2-Speicher. Wenn sie ersetzt werden, wohnen dort im Extremfall weniger Leute als vorher, weil in den Neubauten grössere Wohnungen entstanden sind. In ihren Beiträgen bei Architekturwettbewerben lassen junge Berufsleute heute die Gebäude eher stehen. Die Bauherrschaften tun sich damit immer noch schwer. In den Diskussionen darüber wird die Generationenfrage offensichtlich. Wenn wir mehr Wohnraum schaffen wollen, dann müssen wir bauen. Aber eben, wir müssen nicht abreissen, wir können ergänzen, erweitern, aufstocken.
Hier erfahren Sie mehr zur durchschnittlichen Wohnfläche pro Bewohnerinnen und Bewohner in der Schweiz.
Dann sind Leute, die in einem «Tiny House» leben, Vorreiterinnen und Vorreiter? Ist das die Zukunft oder bloss ein Trend?
«Tiny Houses» sind ein Symptom. Sie sind Ausdruck einer Sehnsucht. Aber sie sind nicht die Lösung unseres Problems, sondern eher ein mediengeschürter Trend, der chic aussieht und nach etwas klingt. Zwar sind sie klein, aber sie brauchen viel Umraum. Im Prinzip sind es Einfamilienhaushalte im Kleinen. Sie können höchstens Lücken füllen.
«‹Tiny Houses› lösen kein Problem. Es ist ein Trend, der chic aussieht und nach etwas klingt.»
Warum hängen wir dermassen am Traum vom eigenen Haus?
Ich glaube, es hat etwas mit Selbstverwirklichung zu tun. Selbst etwas machen und gestalten bedeutet Freiraum haben. Im eigenen Haus kann man die vermeintliche Individualität ausleben, man kann sich einrichten, wie man möchte. Aber ich denke, neue Arten des Zusammenlebens – nennen wir sie alternative Wohnformen – lassen Individualität ebenso zu und fördern die Gemeinschaft.

Würden Sie bestätigen, dass Wohnen unabhängig von der Wohnform immer mit Identität zu tun hat?
Ja, im Grunde schon. Obwohl dem Begriff Identität mehr und mehr eine andere Bedeutung zukommt. Wir haben Identität lange so verstanden, wie Sie: Jeder Mensch hat seine persönliche Vorstellung, wie er leben oder sich darstellen möchte. Identität hat in der heutigen gesellschaftlichen Diskussion zunehmend mit Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zu tun. Identität wird heute mehr mit Gemeinsamkeiten, sei es Alter, Geschlecht, Ethnie, Herkunft, verknüpft als mit Individualität. Man versteht sich zum Beispiel als Bernerin oder als Zürcher. Es ist entscheidend für uns, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind, selbst wenn wir die Anonymität einer Stadt schätzen.
Das bedeutet, dass auch anonym anmutende Mehrfamilienhaussiedlungen – «Klötze», wie Tamedia sie im Mai dieses Jahres in einem Beitrag bezeichnet hat – einen identitätsstiftenden Charakter haben?
Ich fand diesen Artikel im «Tagi» sehr schwierig. Es wurde vieles in einen Topf geworfen. Die Feststellung ist richtig: Es gibt diese Kisten. Und die Anonymität dort kommt von ihrer Gleichförmigkeit. In einer Stadt ist der Strassenraum viel entscheidender als die Gebäude. Denken Sie an Berlin oder an eine Stadt in Italien. Die Gebäude sind sehr unterschiedlich, möglicherweise hässlich. Aber der Raum dazwischen – mit Bäumen bepflanzt, belebt, als Ort, wo die Leute zusammenkommen – gibt einem Quartier den Charakter. Ich glaube, das Problem in der Agglomeration ist ein mehrschichtiges. Da ist einmal das Geld. Wohnraum wird zum Anlageobjekt. Boden wird gehandelt, was eigentlich nicht sein darf, denn Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Gerade für Investoren, bei denen nicht die Wohnzufriedenheit, sondern die Geldanlage im Vordergrund steht, spielt die Qualität der Aussenräume eine untergeordnete Rolle, und das sieht man dann. Natürlich gibt es auch eine ästhetisch gewollte Gleichförmigkeit, die man den Architektinnen und Architekten vorwerfen kann. Aber wenn man sich aktuelle Wohnbauwettbewerbe anschaut, in denen verschiedene Architekturbüros um die beste Lösung für einen Ort ringen, finden Sie «reiche» Neubauten mit lebenswerten Räumen dazwischen. Aber sie sind in der Minderzahl.
«Boden wird gehandelt, was eigentlich nicht sein darf.»
«Klötze» sind also durch Anleger verursacht, die anstelle der architektonisch besten Lösung den maximalen Return on Invest suchen?
Ja, für mich ist das einer der Hauptgründe. Es ist nicht der einzige, aber wohl der wichtigste Grund für solche Bauten. Gute Architektur braucht mehr – nicht zwingend mehr Geld, aber mehr Aufmerksamkeit und Sorgfalt.
Zentralschweizer Mischteig
Unter dem Titel «Zentralschweizer Mischteig» findet sich im Themenheft Dezember 2020 der Zeitschrift «Hochparterre» ein Beitrag von Axel Simon über das Wohnen.
Die Hochparterre AG ist ein Verlag für Architektur, Planung und Design in Zürich, gegründet 1988. «Hochparterre» publiziert eine Monatszeitschrift, eine Fachzeitschrift, Themenhefte, Bücher, unterhält ein Nachrichtenportal und organisiert Veranstaltungen. «Hochparterre» ist seit 2018 Kunde von Stämpfli Kommunikation.